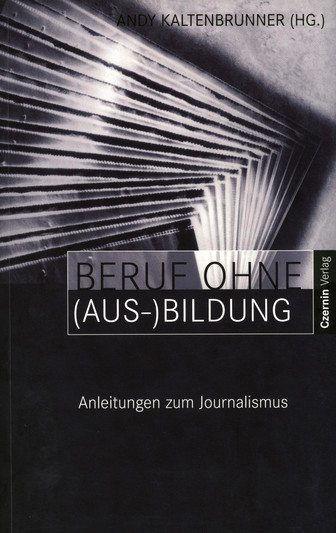
Andy Kaltenbrunner
Beruf ohne (Aus-)Bildung
Anleitungen zum Journalismus
Journalisten sehen sich meist als Berufene, unklar ist aber, was ihre Profession definiert. In Österreich gibt es keine adequate Journalistenausbildung. Universitäten fühlen sich für eine fachliche Schulung der Medienmacher unzuständig, einschlägige Fachhochschulen fehlen und Verlage beschränken sich bei der Nachwuchsrekrutierung meist auf das Angebot kurzer Redaktions-Schnupperlehren für beliebig ausgewählte Interessenten.
Dass gezielte Qualifikationsmaßnahmen für die Medienbranche Sinn machen, bewies zwischen 1995 und 1999 der „redaktionslehrgang magazinjournalismus“ des trend/profil-Verlages in Wien, den 40 Jungjournalisten absolvierten, von denen die meisten inzwischen in österreichischen und deutschen Medien erfolgreich tätig sind. Dutzende Lehrbeauftragte von Universitäten und erfahrene Journalisten aus Österreich und Deutschland unterstützten dieses Ausbildungsprojekt. Im Buch beschreiben am Lehrgang beteiligte Theoretiker, Praktiker und Absolventen ihre Erfahrungen mit dem Einstieg in Medienberufe und dem Selbstverständnis in einem Beruf ohne (Aus-)Bildung.