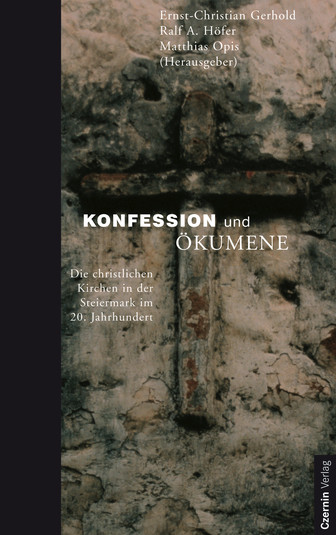
Ernst-Christian Gerhold
Ralf A. Höfer
Matthias Opis
Konfession und Ökumene
Die christlichen Kirchen in der Steiermark im 20. Jahrhundert
„Konfession und Ökumene“ – ist das nicht ein Irrtum? Jahrhunderte lang haben einander die Konfessionskirchen bekämpft, sich des Unglaubens bezichtigt und ihre eigene Identität in Glaubenswahrheiten verabsolutiert. Das eigene Bekenntnis wurde zur Waffe gegen andere Christen, Ökumene als Miteinander stand auf verlorenem Posten.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts – des „Jahrhunderts der Extreme“ (Eric Hobsbawm) – änderte sich diese Ausgangslage grundlegend. Die Stürme zweier Weltkriege, die fortschreitende Erosion christlicher Lebenswelten und Existenzordnungen, der Bedeutungsverlust ethischer Werte, die Konkurrenz und Bedrohung durch politische Ideologien und andere Religionen – dies alles hat die christlichen Kirchen zusammenrücken lassen und ihren Blick für das Gemeinsame geschärft. Vor diesem Hintergrund kam die ökumenische Bewegung in Gang und nahm einen spannenden Verlauf. Mit Beiträgen der Herausgeber sowie von Johannes B. Bauer, Magnus Hofmüller / Erich Linhardt, Heimo Kaindl, Grigorios Larentzakis, Maximilian Liebmann, Christoph Petau, Rudolf Rappel, Ursula Hamachers-Zuba / Reinhard Zuba u. a.